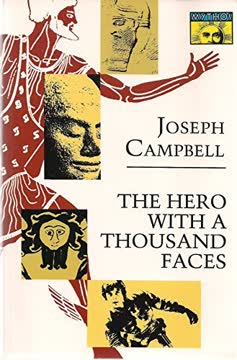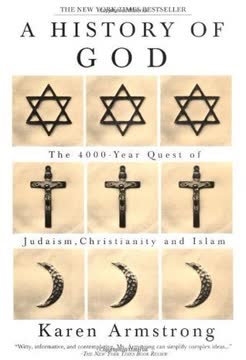Wichtige Erkenntnisse
1. Mythos ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis nach Sinn und Transzendenz.
Wir sind Wesen, die nach Sinn suchen.
Angeborener menschlicher Antrieb. Schon in den frühesten Neandertalergräbern zeigt sich die einzigartige Fähigkeit des Menschen, über die unmittelbare Erfahrung hinaus zu denken, Erzählungen zu schaffen, um sich der Sterblichkeit zu stellen und Sinn zu finden. Anders als Tiere quälen wir uns mit unserem Dasein und erfinden Geschichten, die unser Leben in ein größeres, zugrundeliegendes Muster einordnen.
Die Rolle der Vorstellungskraft. Dieselbe imaginative Kraft, die wissenschaftliche Entdeckungen vorantreibt, erzeugt auch Religion und Mythologie. Mythos bedeutet nicht Flucht aus der Welt, sondern ermöglicht es uns, intensiver in ihr zu leben, indem er den Horizont menschlichen Verstehens und Erlebens über das rein Rational-Erfassbare hinaus erweitert.
Jenseits des Alltäglichen. Die Mythologie spricht von einer unsichtbaren Ebene neben unserer eigenen, einem göttlichen Reich, das die irdische Wirklichkeit trägt. Diese „perenniale Philosophie“ legt nahe, dass alles Hier ein Schatten eines reicheren Archetyps ist, und die Teilhabe an diesem göttlichen Leben erfüllt das menschliche Potenzial, indem sie intuitiv erfasste Wirklichkeiten Gestalt verleiht.
2. Mythos ist untrennbar mit Ritual verbunden und fordert Handeln, nicht nur Glauben.
Ein Mythos ist im Wesentlichen ein Wegweiser; er zeigt uns, was wir tun müssen, um reicher zu leben.
In der Praxis verwurzelt. Mythologie ist außerhalb des liturgischen Dramas oder Rituals, das sie lebendig macht, meist unverständlich. Sie ist keine bloße Erzählung zur Unterhaltung oder Informationsvermittlung, sondern ein Leitfaden, der uns zeigt, wie wir uns verhalten sollen, und uns in die richtige geistige oder psychologische Haltung für richtiges Handeln versetzt.
Wirksamkeit ist Wahrheit. Ein Mythos gilt nicht als „wahr“, weil er faktisch korrekt ist, sondern weil er wirksam ist. Wenn er uns zwingt, Geist und Herz zu verändern, Hoffnung schenkt und uns zu einem erfüllteren Leben antreibt, besitzt er Gültigkeit. Einen Mythos ohne sein begleitendes Ritual zu lesen, ist unvollständig – wie Operntexte ohne Musik zu lesen.
Transformation verlangt. Mythologie verwandelt uns nur, wenn wir sie auf unser eigenes Leben anwenden und Wirklichkeit werden lassen. Sie führt uns über vertraute Gewissheiten hinaus ins Unbekannte und fordert, dass wir uns für immer von ihr verändern lassen – oft begegnet in feierlichen Kontexten geistiger und psychologischer Wandlung wie Initiationsriten.
3. Altsteinzeitliche Mythen spiegelten die Welt des Jägers, den Tod und die Heldenreise wider.
Die erste große Blüte der Mythologie entstand also in einer Zeit, als der Homo sapiens zum Homo necans, dem „tötenden Menschen“, wurde und es sehr schwer hatte, die Bedingungen seiner Existenz in einer gewalttätigen Welt zu akzeptieren.
Überleben und Angst. Für die Jäger der Altsteinzeit war Mythologie lebenswichtig, um mit den Gefahren und der psychischen Zwiespältigkeit des Tötens von Beute umzugehen. Diese frühen Erzählungen, die in späteren Kulturen bewahrt wurden, zeigen eine tiefe Ehrfurcht vor den Tieren, die trotz der Notwendigkeit, sie zu töten, als weise Wesen angesehen wurden.
Heilige Landschaft. Die Naturwelt war durchlässig für das Göttliche; Steine, Bäume und der Himmel wurden nicht als Götter selbst verehrt, sondern als Offenbarungen einer verborgenen, mächtigen Wirklichkeit. Besonders der Himmel vermittelte den Menschen die erste Vorstellung vom Göttlichen als transzendent und ehrfurchtgebietend, ein mysterium tremendum.
Schamane und Held. Frühe Mythen vom Aufstieg, möglicherweise mit dem Himmel verbunden, standen im Zusammenhang mit dem Schamanen, der im Geist in die göttliche Welt für die Gemeinschaft reiste. Dieses Motiv der Heldenreise – das Verlassen des Vertrauten, die Begegnung mit dem Tod und die Rückkehr mit Gaben – wurde in dieser Epoche geprägt und spiegelt die gefährlichen Jagdexpeditionen und Initiationsriten wider.
4. Jungsteinzeitliche Mythen drehten sich um Landwirtschaft, die Muttergöttin und Zyklen von Tod und Wiedergeburt.
Die Landwirtschaft war ein Produkt des Logos, wurde aber – anders als die technologischen Revolutionen unserer Zeit – nicht als rein weltliches Unternehmen betrachtet.
Heilige Landwirtschaft. Die agrarische Revolution führte zu einem spirituellen Erwachen, das den Ackerbau als sakramentale Tätigkeit ansah. Das Beobachten, wie Samen sterben und neues Leben hervorbringen, offenbarte eine verborgene göttliche Kraft, die Erde selbst wurde heilig und als Manifestation des Göttlichen gesehen, oft personifiziert als mütterliche, nährende Muttergöttin.
Gewalt und Erneuerung. Trotz ihres nährenden Bildes behielt die Muttergöttin furchteinflößende Aspekte, die den Kampf der Landwirtschaft gegen Sterilität und die gewalttätigen Kräfte der Natur widerspiegeln. Mythen schilderten, wie ihre Gefährten zerrissen und getötet wurden, was den schmerzhaften Tod des Samens und den ständigen Kampf um Nahrung symbolisierte.
Tod als Übergang. Mythen wie die von Inanna/Dumuzi oder Demeter/Persephone betonten, dass Leben und Tod untrennbar verbunden sind. Diese Geschichten, oft in Ritualen wie den Eleusinischen Mysterien inszeniert, lehrten die Akzeptanz der Sterblichkeit als wesentlichen Teil des Lebens, als notwendigen Tod, der zu geistiger Erneuerung und der Kraft zur Veränderung führt.
5. Frühe Zivilisationen schufen urbane Mythen, die sich mit Ordnung, Chaos und dem Rückzug der Götter auseinandersetzten.
Mit gemischter Furcht und Hoffnung reflektierten die neuen urbanen Mythen den endlosen Kampf zwischen Ordnung und Chaos.
Das Paradox der Zivilisation. Der Aufstieg der Städte brachte Aufregung, Kontrolle über die Umwelt und die Erfindung der Schrift, aber auch Angst vor Verfall und Rückkehr zur Barbarei. Urbane Mythen wie das mesopotamische Enuma Elish spiegelten diesen Kampf wider und sahen die Zivilisation als heroischen Kampf gegen zerstörerische Naturkräfte und sozialen Zerfall.
Götter werden fern. Mit dem Vorrücken menschlicher Erfindungsgabe schienen die Götter immer entfernter, nicht mehr von gleicher Natur wie die Menschen. Flutmythen wie Atrahasis markierten eine Krise im Verhältnis zwischen Göttern und Menschen, indem sie den Rückzug der Götter aus direkter Intervention schilderten und die Menschen auf ihre eigene Technik und Kultur verwiesen.
Mythos trifft Geschichte. Urbane Mythen begannen, in die historische Welt einzudringen, indem Figuren wie Gilgamesch, ein historischer König, zum Gegenstand epischer Dichtungen wurden. Das Gilgamesch-Epos zeigt eine Verschiebung vom Suchen göttlicher Hilfe hin zum Nachdenken über menschliche Begrenztheit und das Finden von Unsterblichkeit in kulturellen Errungenschaften wie Stadtmauern und Schrift.
6. Das Achsenzeitalter brachte geistige Innerlichkeit, Ethik und eine kritische Neubewertung des Mythos.
Alle Weisen wandten sich von der Gewalt ihrer Zeit ab und predigten eine Ethik des Mitgefühls und der Gerechtigkeit.
Wendepunkt der Transformation. Das Achsenzeitalter (ca. 800–200 v. Chr.) sah die Entstehung neuer religiöser und philosophischer Systeme in Eurasien, getragen von einem gemeinsamen Bewusstsein des Leidens und dem Verlangen nach einer spirituelleren, ethischeren Religion. Weise wie die hebräischen Propheten, Buddha, Konfuzius und griechische Philosophen betonten das individuelle Gewissen und Mitgefühl.
Blick nach innen. Diese Traditionen hoben die Notwendigkeit hervor, im Inneren nach Wahrheit zu suchen, alte Werte zu hinterfragen und sich weniger auf äußere Rituale oder priesterliche Autorität zu stützen. Mythologie wurde neu bewertet, oft mit innerlichen und ethischen Deutungen versehen, doch wandten sich die Menschen instinktiv weiterhin alten Mythen zu, um die Geheimnisse der Psyche zu ergründen.
Transzendent, aber fern. Während das Verlangen nach Transzendenz bestehen blieb, erschien das Heilige nun fern, ja fremd, durch eine Kluft von den Sterblichen getrennt. Diese veränderte religiöse Erfahrung machte alte anthropomorphe Mythen problematisch, sodass manche Traditionen, wie die frühe chinesische Hochkultur oder die griechische Philosophie, sich von traditionellen göttlichen Erzählungen entfernten.
7. Monotheistische Traditionen entwickelten komplexe, teils ambivalente Beziehungen zum Mythos.
Haben sich diese Ereignisse wirklich zugetragen oder sind sie „nur“ Mythen?
Geschichte und Mythos. Anders als Traditionen, die Geschichte als Illusion ansehen, glauben Judentum, Christentum und Islam, dass ihr Gott in der Geschichte handelt. Historische Ereignisse werden jedoch erst durch Mythologisierung religiös bedeutsam, indem sie von einzigartigen Begebenheiten zu zeitlosen Geschehnissen werden, die Gläubige durch Ritual und ethisches Handeln erfahren können.
Mythologisierung der Geschichte. Paulus verwandelte den historischen Jesus in einen mythischen Helden, der stirbt und aufersteht – ein Ereignis, das in Taufe und Eucharistie nachgefeiert wird und so für Gläubige spirituelle Wirklichkeit schafft. Ebenso ist die Exodus-Erzählung ein Mythos, der durch Passahrituale und die ethische Forderung nach Freiheit zum Zentrum jüdischen Lebens wurde.
Ambivalenz und Anpassung. Der Monotheismus schien oft den Mythen anderer Völker feindlich gegenüberzustehen, griff aber paradoxerweise auf fremde Geschichten oder Konzepte zurück, um seine eigene Vision auszudrücken. Die Spannung zwischen historischen Ansprüchen und mythischer Interpretation wurde besonders im Westen zu einem wiederkehrenden Thema.
8. Mystik bot einen wichtigen Raum für mythischen Ausdruck innerhalb des Monotheismus.
Mystiker unternehmen eine Reise in die Tiefen der Psyche mittels Konzentrationsdisziplinen, die in allen religiösen Traditionen entwickelt wurden und eine Version der mythischen Heldenreise darstellen.
Erkundung des Inneren. Die Mystik, die sich auf unaussprechliche innere Erfahrungen konzentriert, griff naturgemäß auf Mythologie zurück, um die Reise in die Tiefen der Psyche zu beschreiben. Trotz möglicher Konflikte mit der Orthodoxie verwendeten Mystiker im Judentum (Kabbala), Christentum und Islam mythische Sprache und Strukturen, um ihre Gotteserfahrung auszudrücken.
Neue Mythen entstehen. Kabbalisten entwickelten beispielsweise Schöpfungsmythen und göttliche Emanationen (Sefirot), die wenig mit biblischen Berichten gemein hatten, aber ihre mystischen Einsichten in das verborgene Leben der Gottheit ausdrückten. Der Mythos von der Verbannung und Rückkehr der Shekhinah bot eine kraftvolle Erzählung für jüdisches Leiden und spirituelle Praxis.
Symbolische Wahrheit. Diese mystischen Mythen waren nicht wörtlich zu nehmen, sondern symbolische Ausdrucksformen für das Gefühl einer heiligen Gegenwart oder die Seelenreise. Wie die lurianische Kabbala als Antwort auf die spanische Vertreibung boten sie therapeutische Bedeutung in Krisenzeiten und zeigten die bleibende Kraft des Mythos jenseits rationaler Erklärung.
9. Die westliche Aufklärung stellte das Logos in den Vordergrund und führte zum vermeintlichen „Tod des Mythos“.
Das bedeutete, dass intuitive, mythische Denkweisen zugunsten des pragmatischeren, logischen Geistes der wissenschaftlichen Rationalität vernachlässigt wurden.
Triumph der Vernunft. Die westliche Moderne, gegründet auf technologische Reproduktion und wissenschaftliche Forschung, stellte Logos und Effizienz in den Mittelpunkt. Die Wissenschaft wurde zum neuen Helden, der unbekannte Bereiche erschloss und rationale Beweise forderte, wodurch der Mythos als nutzlos, falsch und veraltet abgewertet wurde.
Mythos wird problematisch. Die neue wissenschaftliche Weltanschauung stellte traditionelle mythische Vorstellungen infrage, etwa die Stellung des Menschen im Kosmos oder die Natur Gottes. Figuren wie Newton lehnten Dogmen wie die Dreifaltigkeit als unlogische Geheimnisse ab, ohne ihre mythisch-symbolische Funktion zu erfassen.
Säkularisierung des Heiligen. Die Betonung der Schrift und des individuellen Lesens in der protestantischen Reformation, verbunden mit der Erfindung des Buchdrucks, veränderte die Wahrnehmung heiliger Texte. Außerhalb des Ritualkontexts und als faktische Information gelesen, wurden biblische Erzählungen zunehmend als „Mythen“ im Sinne von Unwahrheiten betrachtet.
10. Der Verlust des Mythos in der Moderne trug zu Verzweiflung und der Suche nach neuem Sinn bei.
Ohne Mythos, Kult, Ritual und ethisches Leben stirbt das Gefühl des Heiligen.
Spirituelles Vakuum. Mit dem Fortschreiten der Modernisierung und den spektakulären Erfolgen des Logos wurde die Mythologie zunehmend diskreditiert, was ein spirituelles Vakuum hinterließ. Dies führte zu Verzweiflung, Entfremdung und einem Gefühl der Ohnmacht, da der alte mythische Rahmen zur Sinnfindung zerfiel, ohne durch etwas Neues ersetzt zu werden.
Irrationalität bleibt bestehen. Trotz des Zeitalters der Vernunft blieb Irrationalität präsent, sichtbar etwa in Phänomenen wie der Hexenverfolgung, wo unbewusste Ängste in zerstörerische Glaubensvorstellungen rationalisiert wurden. Versuche, rationale Religionen oder massenhafte mystische Bewegungen ohne angemessene Führung zu schaffen, führten mitunter zu psychischen Belastungen und Hysterie.
Mythos missverstanden. Im 19. Jahrhundert galt Mythos oft als unvereinbar mit Wissenschaft und schädlich, was Konflikte wie um Darwins „Entstehung der Arten“ auslöste. Das wörtliche Lesen von Kosmogonien führte zu „schlechter Wissenschaft und schlechter Religion“, und die Höhere Kritik untergrub weitere wörtliche Interpretationen, sodass viele den Glauben selbst gefährdet sahen.
11. Wir brauchen neue, ethisch fundierte Mythen für eine globalisierte und herausgeforderte Welt.
Wir brauchen Mythen, die uns helfen, die Erde wieder als heilig zu verehren, statt sie nur als „Ressource“ zu nutzen.
Dem Nihilismus begegnen. Die dunklen Ereignisse des 20. Jahrhunderts zeigten die Grenzen des Logos allein auf, Sinn zu stiften oder Barbarei zu verhindern. Ohne die mythische Disziplin, sich Tod und Nichts zu stellen, ist Verzweiflung schwer zu vermeiden, und viele vermögen nicht, auf die volle Kraft ihrer Menschlichkeit zurückzugreifen.
Moderne Mythenschöpfung. Obwohl der traditionelle Mythos zurückging, bleiben Menschen mythenbildende Wesen, die zerstörerische moderne Mythen von Ausgrenzung und Egoismus schaffen. Kunst und Literatur füllen das Vakuum, indem sie mythische Themen nutzen, um moderne Dilemmata zu erforschen und ein Gefühl gemeinsamer Erfahrung und Mitgefühl zu vermitteln.
Ein Aufruf zur Erneuerung. Wir brauchen Mythen, die mit der Ethik des Achsenzeitalters durchdrungen sind – Mitgefühl, Gerechtigkeit und Respekt vor allem Leben –, um zerstörerischen Erzählungen entgegenzuwirken und globale Herausforderungen wie Umweltzerstörung anzugehen. Diese neuen Mythen müssen uns helfen, Selbstsucht zu überwinden, transzendente Werte zu erfahren und die Welt wieder als heilig zu sehen.
Zuletzt aktualisiert:
Rezensionen
Eine kurze Geschichte des Mythos bietet einen prägnanten Überblick über die Entwicklung der Mythologie von der Altsteinzeit bis zur Gegenwart. Während manche Leser das Werk als aufschlussreich und gut geschrieben empfanden, kritisierten andere die weitreichenden Verallgemeinerungen und die fehlende Tiefe. Armstrong vertritt die Auffassung, dass Mythen für das menschliche Streben nach Sinn und spiritueller Erfüllung unverzichtbar sind – selbst in unserem wissenschaftlich geprägten Zeitalter. Das Buch zeigt auf, wie Mythen gesellschaftliche Veränderungen und menschliche Bedürfnisse in verschiedenen Epochen widerspiegeln. Viele Leser schätzten Armstrongs zugänglichen Schreibstil, während andere die Vereinfachung komplexer Themen bemängelten. Besonders gelobt wurde das abschließende Kapitel, das sich mit der modernen Mythenbildung in Kunst und Literatur beschäftigt.