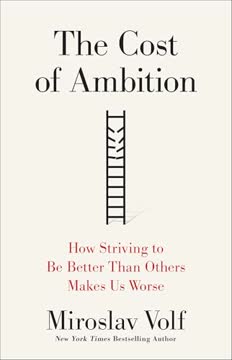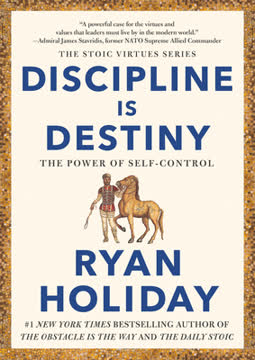Wichtige Erkenntnisse
1. Das Streben nach Überlegenheit: Eine allgegenwärtige und zerstörerische Kraft
Ein Gefühl der Minderwertigkeit treibt das Streben nach Überlegenheit an, und dieses Streben wird zugleich von Stolz und Minderwertigkeitsgefühlen überschattet.
Allgegenwärtiger Antrieb. Das Verlangen, besser zu sein als andere, ist eine tief verwurzelte menschliche Neigung, die sich von antiken Kaisern wie Justinian zeigt, der sich rühmte, Solomon beim Bau der Hagia Sophia übertroffen zu haben, bis hin zu alltäglichen Vergleichen über Autos oder Likes in sozialen Medien. Dieses Streben unterscheidet sich vom Streben nach Exzellenz, das auf Selbstverbesserung abzielt, denn Überlegenheit bedeutet oft, andere herabzusetzen oder ihren Erfolg zu behindern. Das Buch argumentiert, dass das Streben nach Überlegenheit zwar instrumentelle Vorteile bringen kann (wie den Ruhm von Lionel Messi), sein moralischer Wert jedoch höchst fragwürdig ist.
Gesellschaftlicher Schaden. Dieses allgegenwärtige Verlangen nach Überlegenheit durchdringt nahezu jeden Bereich des modernen Lebens – vom Sport und der Bildung bis hin zur Politik und den sozialen Medien. Es erzeugt einen unerbittlichen Druck, sich zu messen, was zu weit verbreiteten psychischen Problemen wie Depressionen führt, die der Autor als „Krankheit der Unzulänglichkeit“ bezeichnet. Der ständige Vergleich, besonders auf kuratierten Social-Media-Plattformen, fördert Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, Essstörungen und ein sinkendes Selbstwertgefühl, vor allem bei Jugendlichen.
Verfall von Werten. Wenn Überlegenheit zum dominierenden Wert wird, kann sie die Güter, die sie zu erreichen vorgibt, selbst zerstören. So verlagert sich etwa im harten Wettbewerb um Elitebildung der Fokus vom Lernen um des Lernens willen hin zum bloßen Statusgewinn, wie sich in Zulassungsskandalen und der Korrelation von Reichtum mit der Aufnahme an selektiven Schulen zeigt. Ebenso kann in der Politik das Streben nach Dominanz das Gemeinwohl verdrängen und zu einer „Wahrheitsverflachung“ führen, bei der Führungspersönlichkeiten den Wahlsieg über die faktische Wahrheit stellen und Unehrlichkeit belohnen.
2. Die „Sorge des Vergleichs“ vergiftet das Selbstwertgefühl
Die Flucht vor Minderwertigkeit durch das Streben nach Überlegenheit tötet sie.
Das Klagelied der Lilie. Søren Kierkegaard veranschaulicht die Gefahr des Vergleichs mit dem Gleichnis von einer zufriedenen Feldlilie. Als sie von einem „frechen Vogel“ erfährt, dass anderswo prächtigere Lilien wachsen, wird die kleine Lilie von der „Sorge des Vergleichs“ ergriffen und sehnt sich danach, eine „Kaiserkrone“ zu werden, um von allen beneidet zu werden. Dieses rastlose Streben, geboren aus wahrgenommener Minderwertigkeit, führt letztlich zu ihrem Verwelken und Tod in der vergeblichen Suche nach äußerer Bestätigung.
Untergrabung der Menschlichkeit. Kierkegaard beschreibt diese „rastlose Vergleichsmentalität“ als eine „verderbliche Art der Befleckung“, die die Seele schädigt. Sie führt zu:
- Ständiger Sorge: Ob man nun hoch oder niedrig auf der Vergleichsskala steht, Menschen quält die Angst – entweder wie sie aufsteigen oder wie sie nicht überholt werden können.
- Verlust der Einzigartigkeit: Wettbewerbsvergleiche nivellieren individuelle Besonderheiten und reduzieren Menschen auf ihren Erfolg oder Misserfolg auf einer oft willkürlichen Skala.
- Verlust des Selbst: Menschen zerstreuen sich, warten ständig auf äußere Bestätigung, um zu definieren, „was sie in diesem Moment sind“, was zu einem fragilen und instabilen Identitätsgefühl führt.
Fiktive Erhabenheit. Für Kierkegaard ist die „Erhabenheit“ oder Überlegenheit, nach der Menschen streben, eine Fiktion. Zwar mögen die angestrebten Eigenschaften (z. B. Schönheit, Intelligenz) real sein, doch das daraus abgeleitete Überlegenheitsgefühl ist illusorisch und entmenschlichend. Er betont, dass unsere „bloße Menschlichkeit“ eine unermesslich größere Herrlichkeit ist als jede weltliche Auszeichnung, und dass das Streben nach äußerer Erhabenheit auf Kosten dieser Menschlichkeit eine Form geistiger „Verzweiflung“ darstellt – ein Selbstverrat, der zu einem gespenstischen Dasein führt.
3. Satans Ehrgeiz: Die Sinnlosigkeit ultimativer Überlegenheit
Bis Stolz und schlimmer Ehrgeiz mich stürzten, im Krieg gegen den unvergleichlichen König des Himmels.
Rebellion gegen das Geschöpfsein. In John Miltons Paradise Lost ist Satans Streben nach Überlegenheit der kosmische Motor des Bösen. Als „erster Erzengel, groß an Macht“ kann Satan es nicht ertragen, einen Überlegenen zu haben, und betrachtet die Erhöhung des Sohnes Gottes als „verletztes Verdienst“. Seine Rebellion richtet sich nicht gegen Ungerechtigkeit, sondern gegen seine eigene ontologische Minderwertigkeit als Geschöpf. Um seine große Rebellion zu rechtfertigen, erfindet Satan eine falsche Ideologie der selbstgeschaffenen Engel und zeigt so, wie das Streben nach Überlegenheit oft eine Verzerrung der Wirklichkeit erfordert.
Die Qual der Selbstverachtung. Satans Monolog offenbart die quälende Wahrheit: Sein Krieg gegen Gott war eine „böse Antwort auf empfangenes Gut“, genährt von einer „grenzenlosen Hoffnung“, der „Höchste“ zu sein. Seine Unfähigkeit zur Reue rührt von der unerträglichen Scham, Minderwertigkeit anzuerkennen, was zu einem Kreislauf der Selbstverachtung führt, obwohl er auf dem Thron der Hölle „verehrt“ wird. Dieses „Elend“ ist die „Freude, die der Ehrgeiz findet“ und zeigt, wie frustriertes Streben nach Überlegenheit darin münden kann, Konkurrenten zu schaden, indem man zerstört, was sie erfreut – selbst wenn es Selbstzerstörung bedeutet.
Evas kompromittierter Ehrgeiz. Auch Evas Fall wurzelt in einem Wunsch nach Überlegenheit, wenn auch in begrenzterem Maße. Satan nutzt ihre Unzufriedenheit mit Adams intellektueller Überlegenheit aus, schmeichelt ihr als „herrschaftliche Herrin“ und „universale Dame“. Nach dem Verzehr der verbotenen Frucht hofft Eva, „die Chancen des Wissens in meiner Macht zu behalten“ und „manchmal überlegen“ gegenüber Adam zu sein, überzeugt davon, dass „wer frei ist, wenn er unterlegen ist?“ Ihre Entscheidung, die Frucht mit Adam zu teilen, entspringt nicht der Liebe, sondern der Angst vor ultimativer Minderwertigkeit, falls sie sterben und er mit einer anderen Eva weiterleben sollte.
4. Wahre Herrlichkeit liegt im demütigen Dienst, nicht im Streben nach Status
Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesu jedes Knie sich beuge, im Himmel und auf Erden und unter der Erde, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.
Christi Abstieg. Der Apostel Paulus stellt Jesus Christus als das ultimative Gegenbeispiel zum Streben nach Überlegenheit dar. Im Carmen Christi (Philipper 2,6-11) wird Christus, obwohl er in „Gottes Gestalt“ existiert und Gott gleich ist, nicht als etwas betrachtet, das er „festhalten“ müsse. Stattdessen „entäußerte er sich selbst“, nahm die „Gestalt eines Knechtes“ an und erniedrigte sich bis zum Tod am Kreuz – der ultimative „Wettlauf der Schande“. Diese radikale Selbsterniedrigung war kein Mittel zur Erlangung von Status, sondern der Kern seiner göttlichen Herrlichkeit.
Herrlichkeit im Selbstgeben. Gottes anschließende Erhöhung Christi ist keine Belohnung für sein Leiden, sondern eine öffentliche Bestätigung, dass diese selbstgebende Liebe Herrlichkeit ist. Christi Herrlichkeit besteht nicht darin, göttliche Überlegenheit zu bewahren oder andere zu beherrschen, sondern darin, anderen zu dienen – selbst den Verachteten – bis zum schändlichen Tod. Dies zeigt, was es bedeutet, der „Höchste“ zu sein angesichts der Zerbrechlichkeit und Bedürftigkeit der Geschöpfe.
Ein neuer Maßstab. Paulus fordert Christen auf, diese „Gesinnung Christi“ anzunehmen und „nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht zu tun, sondern in Demut die anderen höher zu achten als sich selbst“ (Philipper 2,3). Das bedeutet, aktiv die Interessen anderer zu suchen und sie zu behandeln, als hätten sie einen höheren Rang und größere Bedeutung – unabhängig von deren Verdienst. Diese gegenseitige Ehrung, verwurzelt im Beispiel Christi, destabilisiert weltliche Hierarchien und fördert eine Gemeinschaft bedingungsloser Fürsorge und geteilter Ehre.
5. Jeder menschliche Wert ist ein Geschenk und schließt Prahlerei aus
Was hast du, das du nicht empfangen hast? Und wenn du es empfangen hast, warum rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen?
Die Illusion des Selbstgemachten. Paulus stellt die Grundlage von Prahlerei und Überlegenheitsstreben direkt infrage, indem er fragt: „Wer macht dich anders als einen anderen? Was hast du, das du nicht empfangen hast?“ (1 Korinther 4,7). Die Antwort ist implizit: nichts. Jeder Aspekt des Menschen – seine Existenz, Fähigkeiten, Leistungen und sogar seine Gerechtigkeit vor Gott – ist ein Geschenk. Daher ist jeder Anspruch, sich selbst in eine überlegene Stellung gearbeitet zu haben, eine „existenzielle Falschheit“, eine Lüge, die die „Weisheit“ einer vergänglichen Welt stützt.
Ruhm nur im Herrn. Paulus, einst ein eifriger Streiter um religiöse Überlegenheit, betrachtete seine früheren „Errungenschaften“ (Abstammung, Gesetzestreue) nach der Begegnung mit Christus als „Verlust“ oder „Mist“. Seine neue Identität ist „nicht eine eigene Gerechtigkeit... sondern die durch den Glauben an Christus“ (Philipper 3,9). Diese „fremde Gerechtigkeit“ ist Gottes Geschenk und schließt Prahlerei aus. Die einzige legitime Prahlerei ist „im Herrn“ (1 Korinther 1,31), indem Christus als alleinige Quelle wahrer Weisheit, Kraft und Stellung anerkannt wird – und damit alle Ansprüche auf persönliche Überlegenheit enden.
Gegenseitige Belohnung. Paulus definiert „Lohn“ so um, dass Wettbewerb entfällt. Wenn er von seiner „Krone des Ruhms“ spricht, ist das kein individueller Preis für seine Anstrengungen, sondern die Menschen, denen er gedient hat: „Seid ihr es nicht? Ja, ihr seid unser Ruhm und unsere Freude!“ (1 Thessalonicher 2,19-20). Diese gegenseitige Freude bedeutet, dass alle, die Christi Weg annehmen, einander Lohn sind und gemeinsam Christi Krone bilden. Dieses geteilte, nicht-exklusive Belohnungssystem macht das Streben nach individueller Überlegenheit zum Widerspruch.
6. Gottes „Torheit“ definiert Macht und Weisheit neu
Gottes Torheit ist weiser als menschliche Weisheit, und Gottes Schwäche ist stärker als menschliche Stärke.
Herausforderung weltlicher Maßstäbe. Paulus konfrontiert die Gemeinde in Korinth, die von „Super-Aposteln“ beeinflusst wurde und statt Paulus’ „Wort vom Kreuz“ eine „Theologie der Herrlichkeit“ mit eloquenten, mächtigen Führern bevorzugte. Für sie erschien Paulus’ Botschaft von einem gekreuzigten Christus töricht und schwach. Paulus erklärt, dass diese scheinbare „Torheit“ und „Schwäche“ Gottes tatsächlich „weiser als menschliche Weisheit“ und „stärker als menschliche Stärke“ ist (1 Korinther 1,25). Dies ist kein Wettbewerbsanspruch, sondern die Feststellung einer unveränderlichen Realität: die Vergänglichkeit menschlicher Macht gegenüber der bleibenden Wahrheit von Gottes selbstgebender Liebe.
Gottes umgekehrte Logik. Gottes Erlösungsmethode ist es, „das Torhafte in der Welt zu erwählen, um die Weisen zu beschämen; Gott erwählte das Schwache in der Welt, um die Starken zu beschämen; Gott erwählte das Niedrige und Verachtete in der Welt, Dinge, die nicht sind, um Dinge, die sind, aufzuheben“ (1 Korinther 1,27-28). Diese göttliche Strategie zielt darauf ab, die „Struktur des Prahlens“ zu zerstören, damit „niemand sich vor Gott rühmen kann“. Es geht nicht nur darum, die Verhältnisse umzukehren (Schwache stark zu machen), sondern die Maßstäbe der Überlegenheit selbst abzuschaffen und eine Gemeinschaft zu schaffen, in der alle gleich geehrt werden.
Das Paradox der Prahlerei. In seinem zweiten Brief an die Korinther, angesichts heftiger Opposition, prahlt Paulus ironischerweise, um die Torheit der Werte seiner Gegner bloßzustellen. Er rühmt sich nicht seiner Stärken, sondern seiner Schwächen – Leiden, Verfolgungen und Gefahren –, die aus weltlicher Sicht ihn zum „unterlegenen Apostel“ machen. Diese „Torheitssprache“ (2 Korinther 11,16–12,10) zeigt, dass selbst eine „umgekehrte Prahlerei“ eine „fleischliche Prahlerei“ bleibt, da jede Prahlerei auf eigener Leistung beruht, um Überlegenheit zu behaupten. Paulus’ letztendliche Botschaft ist, dass alle Prahlerei problematisch ist, weil wahre Handlungsfähigkeit Christus gehört, der in ihm lebt.
7. Biblische Erzählungen kritisieren konsequent das Streben nach Vorrang
Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein.
Jesu radikale Umkehrung. Jesus stellt das Streben nach Status beständig infrage. Als Jakobus und Johannes frech die höchsten Plätze in seinem kommenden Reich fordern, tadelt Jesus ihr „Ranggerangel“. Er erklärt: „Wer unter euch groß werden will, sei euer Diener, und wer unter euch der Erste sein will, sei aller Knecht“ (Markus 10,43-44). Dies ist kein Aufruf, die Hierarchie umzudrehen (Minderwertigkeit zur neuen Überlegenheit zu machen), sondern Überlegenheit selbst zur „Nicht-Wertigkeit“ zu erklären. Dienst ist das Ziel, nicht ein Mittel, sich über andere zu erheben.
Alttestamentliche Vorbilder. Die Kritik am Streben nach Überlegenheit ist tief im hebräischen Bibeltext verankert:
- Kain und Abel: Kains Mord an Abel entspringt dem Wunsch, seine wahrgenommene Überlegenheit wiederherzustellen, nachdem Gott Abels Opfer bevorzugt.
- Abrahams Berufung: Gottes Wahl Abrams (Genesis 12,1-3) wird als unverdiente Gnade dargestellt, nicht basierend auf Eigenschaften oder Leistungen, und schließt so jeden Anspruch auf Überlegenheit aus.
- Israels Erwählung: Deuteronomium 7,6-8 betont ausdrücklich, dass Israel nicht wegen seiner Größe oder anderer Merkmale erwählt wurde, sondern „weil der Herr euch liebte“. Diese unverdiente Erwählung macht es „unmöglich, Erwählung mit Überlegenheit zu identifizieren“.
- Schöpfung Adams: Rabbinische Gelehrte interpretieren Adams einsame Erschaffung (Genesis 1) als Mittel, um zukünftiges Prahlen zu verhindern („Mein Vater ist größer als dein Vater“) und die gemeinsame Herkunft sowie gleiche Würde aller Menschen zu betonen.
Die fehlbaren Streber. Selbst grundlegende Figuren wie Jakob und Joseph werden als intensive Streber nach Überlegenheit dargestellt. Jakob handelt skrupellos, um Esau das Erstgeburtsrecht abzuringen und täuscht seinen Vater um den Segen. Joseph, ein narzisstischer Jugendlicher, zeigt seine bevorzugte Stellung offen, was zu seiner Versklavung führt. Obwohl beide später Wandlungen durchlaufen und Gottes Wirken in ihrem Leben anerkennen, verdeutlichen ihre Anfangshandlungen die zerstörerische Natur ihres Ehrgeizes.
8. Göttliche Vorsehung wirkt durch Fehler hindurch, rechtfertigt sie aber nicht
Ihr habt es zwar böse gemeint gegen mich, aber Gott hat es zum Guten gewollt, um ein großes Volk zu erhalten, wie es heute noch geschieht.
Gottes krumme Linien. Die biblische Erzählung, besonders in Genesis, zeigt Gottes Vorsehung, die selbst durch menschliche moralische Fehler wirkt. Josephs Worte an seine Brüder, „Ihr habt es zwar böse gegen mich gemeint, aber Gott hat es zum Guten gewollt“ (Genesis 50,20), fassen dieses Thema zusammen. Gott nutzt den grausamen Akt des Verkaufs Josephs in die Sklaverei, um die Nachkommen Jakobs während einer Hungersnot zu bewahren. Ebenso wirkt Gott durch Jakobs Täuschung, um ihn zum Stammvater Israels zu machen.
Keine „unsichtbare Hand“. Diese göttliche Vorsehung gleicht nicht Adam Smiths „unsichtbarer Hand“, die private Laster in öffentliche Güter verwandelt und so Eigennutz und Überlegenheitsstreben rechtfertigt oder gar verherrlicht. Die Bibel beschönigt oder entschuldigt die moralischen Fehler ihrer Figuren nicht. Sie verurteilt Jakobs Skrupellosigkeit und Josephs Narzissmus, auch wenn sie anerkennt, dass Gottes übergeordnete Zwecke durch diese fehlerhaften Handlungen erreicht wurden.
Verurteilung ohne Rechtfertigung. Der Text betont, dass Gott „weiß, wie man mit krummen Linien gerade schreibt“, also Gutes trotz menschlicher Sünde bewirken kann, ohne die Krummheit der Sünde selbst zu „richten“ oder zu rechtfert
Zuletzt aktualisiert:
Rezensionen
„Die Kosten der Ambition“ wird von den Lesern hoch gelobt und erreicht eine durchschnittliche Bewertung von 4,36 von 5 Sternen. Besonders geschätzt wird Volfs zugänglicher Schreibstil sowie seine tiefgehende Analyse, wie das Streben nach Überlegenheit den christlichen Glauben und das persönliche Leben negativ beeinflusst. Das Buch zieht Werke von Kierkegaard, Milton und dem Apostel Paulus heran, um die moralischen Fallstricke der Ambition anschaulich darzustellen. Viele Leser empfanden das Werk als anregend, herausfordernd und äußerst relevant für das moderne Leben – vor allem im Kontext des westlichen Kapitalismus und der digitalen Kultur.